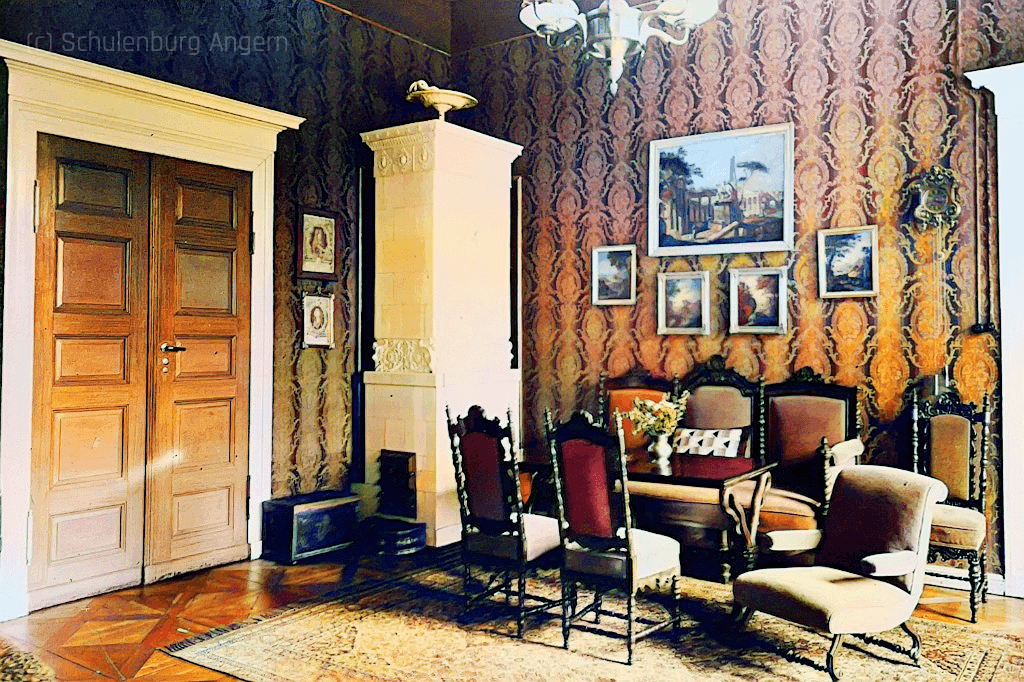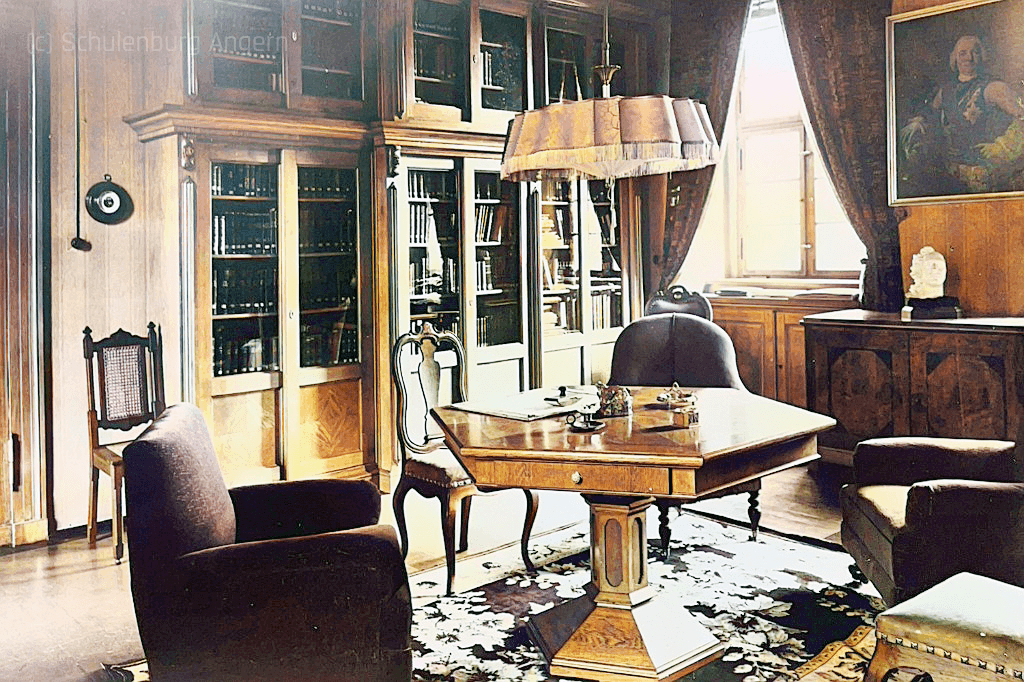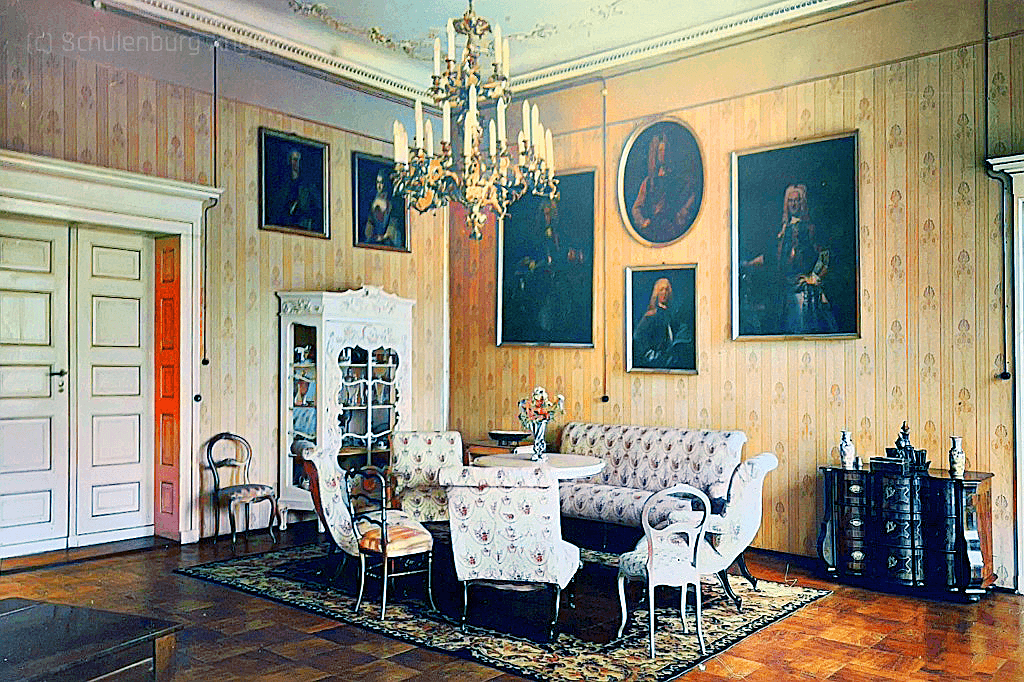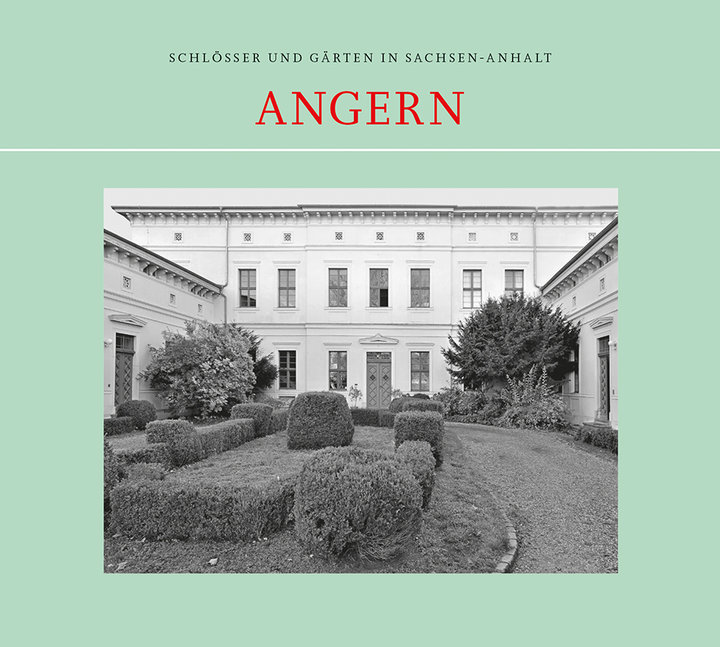Fritz I. von der Schulenburg (1350–1415) war der gemeinsame Stammvater aller drei Hauptlinien des sogenannten weißen Stamms des Hauses von der Schulenburg. Seine Lebenszeit fällt in eine Epoche tiefgreifender politischer und gesellschaftlicher Umbrüche im deutsch-römischen Reich.
Die Mark Brandenburg befand sich in einer Phase des Übergangs von der luxemburgischen zur hohenzollernschen Herrschaft, und Fritz I. trat als aktiver Teilnehmer dieses Wandels hervor.
Herkunft und Zeitumfeld
Geboren wurde Fritz um das Jahr 1350 auf Beetzendorf als Sohn Bernhard V von der Schulenburg und Margarete, geb. von Wedderde. Zeitgleich mit seinem Geburtsjahr wurden an der Mosel die Fundamente von Burg Eltz gelegt, der Schiefe Turm von Pisa vollendet und in England der Hosenbandorden durch König Eduard III. gestiftet – kulturelle und politische Markierungen einer bewegten Epoche.
Politischer Kontext und Hohenzollern-Übergang
Fritz I. erlebte 1373 die Übergabe der Mark Brandenburg von Otto dem Faulen (Wittelsbacher) an Kaiser Karl IV. (Haus Luxemburg), der das Gebiet als Teil der kaiserlichen Hausmacht übernahm. Nach Karls Tod ging die Mark an seinen Sohn Sigismund I. über, der 1410 zum König des römisch-deutschen Reichs gewählt wurde. Da Sigismund jahrelang nicht persönlich in der Mark anwesend war, setzte er zwei Statthalter ein: Pfalzgrafen Ludwig III. und Friedrich VI. von Nürnberg, Burggraf von Nürnberg.
Fritz I. gehörte zu den märkischen Ständevertretern, die Sigismund in Ofen (Budapest) huldigten. Nach der Rückkehr verweigerten sie jedoch Friedrich VI. zunächst die Huldigung – ein symbolischer Akt des Widerstands gegen die fränkische Dominanz. Erst nach zwei energischen Mahnschreiben Sigismunds willigte Fritz im November 1412 ein.
Als die Mark Brandenburg 1411 nach dem Tod des Markgrafen Jost faktisch unbesetzt war, wurde eine Abordnung der märkischen Stände nach Ofen (heute Budapest) geschickt, um dem neuen Herrn, König Sigismund, zu huldigen. In den Tagen der Muße in Ofen wird Fritz I. diesem neumodischen Minnesänger Oswald von Wolkenstein zugehört haben, der recht raue Lieder aus seinem bewegten Leben zum Besten gab. Zu den Abgesandten gehörte auch Fritz I. von der Schulenburg. In den darauffolgenden Tagen kündigte Sigismund überraschend an, Friedrich VI. zum Hauptmann und Verweser der Mark zu ernennen. Obwohl die märkischen Stände dies zunächst in Ofen akzeptierten, verweigerten sie nach ihrer Rückkehr die Huldigung – auch Fritz I. gehörte zu den Verweigerern. Diese Ablehnung war Ausdruck eines zunehmenden Konflikts zwischen dem selbstbewussten märkischen Adel und der sich formierenden zentralen Macht.
In die Mark zurückgekehrt, lehnen sie jedoch die Huldigung ab, auch Fritz I. Es beginnt nun die Zeit, die als "Quitzowzeit" bekannt ist und in der Friedrich VI. mit fränkischen Rittern die Macht des märkischen Adels bricht. (Friedel Hohenlohe-Waldenburg erzählte mir am 25.7.83, einer seiner Vorfahren sei bei den Kämpfen mit den Quitzows gefallen).
Fehden, Konflikte und Versöhnung
Die politische Lage in der Mark Brandenburg gegen Ende des 14. und zu Beginn des 15. Jahrhunderts war von einem tiefgreifenden Umbruch geprägt. Die alte landständische Ordnung, in der der märkische Adel weitreichende Eigenständigkeit genoss, wurde durch den Machtzuwachs der Hohenzollern herausgefordert. Fritz I. von der Schulenburg erlebte diesen Wandel nicht nur als Zeitzeuge, sondern als aktiver Akteur in einem der dramatischsten Kapitel der märkischen Adelsgeschichte: dem Übergang der Landesherrschaft an das Haus Hohenzollern und dem damit verbundenen Machtverlust der altmärkischen Ritterschaft.
Nach dem Tod des letzten Wittelsbacher Markgrafen Jost von Mähren fiel die Mark 1411 an König Sigismund aus dem Hause Luxemburg. Dieser setzte Burggraf Friedrich VI. von Nürnberg als Statthalter ein, der als späterer Kurfürst Friedrich I. Brandenburg grundlegend reformieren sollte. Die Mehrheit des märkischen Adels, darunter auch Fritz I., lehnte jedoch die Huldigung an den neuen Statthalter ab – aus Sorge, ihre hergebrachten Rechte und Privilegien zu verlieren. Damit begann die sogenannte „Quitzow-Zeit“, benannt nach den einflussreichen Brüdern Hans und Dietrich von Quitzow, die gemeinsam mit anderen Adelsfamilien wie den Gans zu Putlitz, Alvensleben und Schulenburg den offenen Widerstand organisierten.
Fritz I. gehörte zu den maßgeblichen Wortführern dieser Opposition. Ein Schreiben König Sigismunds vom 12. August 1412 mahnte ihn ausdrücklich zur Unterwerfung unter Friedrich VI. – ein deutliches Zeichen seiner exponierten Stellung. Doch selbst ein weiteres Mahnschreiben brachte ihn nicht unmittelbar zur Huldigung. Erst gegen Ende des Jahres 1412 schloss sich Fritz I. dem Lager der Städte und gemäßigten Ritter an und huldigte dem neuen Landesherrn – ein Schritt, der wohl aus Realismus und politischer Klugheit geschah, weniger aus Überzeugung.
Trotz dieses späten Einlenkens war Fritz I. in zahlreiche Fehden und Übergriffe verwickelt, wie aus einer Klageschrift des Erzbischofs von Magdeburg hervorgeht. Darin werden er und seine „Knechte“ ausdrücklich für Gewalttaten verantwortlich gemacht – etwa Plünderungen, Brandschatzungen und widerrechtliche Inbesitznahmen kirchlicher Güter. Diese Konflikte spiegeln die Zerrissenheit des märkischen Adels wider, der sich zunehmend zwischen ständischer Unabhängigkeit und landesherrlicher Zentralisierung behaupten musste.
Die militärische Antwort Friedrichs VI. war hart und effizient. Mit Söldnern aus Franken und moderner Belagerungstechnik, darunter dem berühmten Geschütz „Faule Grete“, ließ er eine Burg nach der anderen stürmen oder schleifen. Auch Besitzungen der Quitzows, Gans zu Putlitz und anderer rebellischer Adelsgeschlechter wurden zerstört oder konfisziert. Historische Darstellungen aus dem 19. Jahrhundert zeigen eindrucksvoll die Unterwerfung der Quitzows – stellvertretend für den Niedergang des alten Fehdewesens.
Fritz I. gelang es jedoch, die Gunst des neuen Kurfürsten zu erlangen. Bereits am 12. April 1414, nur ein Monat nach der endgültigen Niederlage der Opposition, bestätigte ihm Kurfürst Friedrich I. alle bisherigen Rechte seines Hauses, darunter auch das erbliche Amt des Erbküchenmeisters der Mark Brandenburg. Diese frühe Versöhnung deutet auf einen strategischen Sinn für politische Wendungen hin: Fritz I. hatte sich im entscheidenden Moment neu positioniert und damit die Zukunft seiner Linie gesichert.
In der Folgezeit ordnete sich das Haus Schulenburg unter der Führung von Fritz I. dem neuen landesherrlichen Kurs unter, nahm aber auch aktiv am Wiederaufbau und an der neuen Landfriedensordnung teil. Der Konflikt markiert damit nicht nur einen Bruch mit der mittelalterlichen Fehdekultur, sondern auch den Beginn der Integration des altmärkischen Adels in eine frühneuzeitliche Territorialstaatlichkeit unter den Hohenzollern.
Familie und Nachkommen
Fritz I. war mit Hippolyta von Jagow verheiratet, einer Tochter des Hermann von Jagow (*1346). Aus der Ehe gingen mindestens drei Söhne hervor, die jeweils die drei Hauptlinien des weißen Stamms begründeten:
- Busso I. von der Schulenburg (um 1394/1396-1475), Stammvater der älteren Linie des weißen Stamms (weitere Infos);
- Bernhard VIII. von der Schulenburg, Knappe (1427-1469), Stammvater der mittleren Linie des weißen Stamms (z. B. Reinsdorf, Schochwitz) (weitere Infos);
- Matthias I. von der Schulenburg (1427-1479), Stammvater der jüngeren Linine des weißen Stamms.
Diese genealogische Differenzierung legte die Grundlage für die spätere territoriale Aufteilung der Familie in Altmark und angrenzende Regionen. Die Erblinien bildeten bis ins 18. Jahrhundert eigenständige Besitzkomplexe und Herrschaften.
Der Aufstieg Friedrichs VI. zum Kurfürsten
Die politische Neuordnung in der Mark Brandenburg kulminierte in einem Ereignis von grundsätzlicher Bedeutung: der formellen Belehnung Friedrichs VI. von Hohenzollern mit der Mark Brandenburg im Jahr 1415. Nachdem dieser sich mit militärischer Macht – auch gegen den Widerstand von Teilen des märkischen Adels – durchgesetzt hatte, wurde er von König Sigismund auf dem Konzil zu Konstanz am 30. April 1415 feierlich mit der Mark Brandenburg belehnt. Von seiner Residenz Tangermünde aus erlässt Friedrich VI. eine strenge Landfriedensordnung für die Mark.
Diese Belehnung war nicht nur ein symbolischer Akt, sondern ein strukturpolitischer Wendepunkt: Sie begründete dauerhaft die Herrschaft der Hohenzollern in Brandenburg und legte den Grundstein für den späteren preußischen Staat. Der Akt selbst erfolgte mit großem zeremoniellem Aufwand. Der neue Kurfürst wurde von einem Reiterzug abgeholt, dem König am Fenster des „Hohen Hauses“ vorgestellt, und offiziell mit der Mark belehnt. Die Zeremonie ist in der illustrierten Chronik des Konzils von Konstanz überliefert. Der Bericht über die Belehnung ist in der bebilderten Chronik des Konstanzer Konzils enthalten, das primär der Glaubenseinheit galt und deswegen dem Reformator Hus dort das Leben kostete. Die Belehnung lief formal wie folgt ab:
- Friedrich I. wird von einem Reiterzug aus seiner Wohnung abgeholt.
- König Sigismund zeigt sich am Fenster des Hohen Hauses am Markt zu Konstanz.
- König Sigismund nimmt die Belehnung vor.
- Kurfürst von Brandenburg mit seinem Standartenträger, dahinter das Banner der Hohenzollern nach der Belehnung.
Ob Fritz I. an dieser Belehnungsfeier teilnahm, ist nicht belegt. Zwar war er seit 1412 wieder als loyaler Vasall Friedrichs VI. akzeptiert, doch fehlen Hinweise auf eine unmittelbare Verbindung zum Hoflager des Burggrafen oder eine Reise nach Konstanz. Es ist wahrscheinlich, dass Fritz, der sich zuvor heftig gegen den neuen Landesherrn gestellt hatte, in dieser Phase bereits im Hintergrund blieb. Sein Wirken hatte sich damit mehr und mehr in das regionale Umfeld Altmark und die Absicherung seiner Familieninteressen verlagert.
Letzte Jahre und Tod
In den letzten Jahren seines Lebens hatte Fritz I. von der Schulenburg seine Position als markbrandenburgischer Vasall gefestigt. Die königliche Bestätigung aller Familienrechte am 12. April 1414, insbesondere des erblichen Amtes des Erbküchenmeisters der Mark Brandenburg, war Ausdruck einer weitgehenden Versöhnung mit dem neuen Haus Hohenzollern.
Nach Jahrzehnten voller politischer Umbrüche, kriegerischer Auseinandersetzungen und sozialer Reibung erlebte er damit noch einmal eine Phase relativer Stabilität. Die Fehden gegen Städte, geistliche Fürsten und konkurrierende Adelsfamilien ebbten ab, der Übergang zur harten, aber konsolidierten Herrschaft Friedrichs I. war abgeschlossen.
Fritz I. starb Ende 1415 oder Anfang 1416, vermutlich auf einem seiner altmärkischen Besitzsitze, etwa in Beetzendorf. Mit ihm endete die erste Generation des weißen Stammes, die den tiefgreifenden Wandel vom späten Mittelalter zur frühen Neuzeit unmittelbar miterlebt und mitgeprägt hatte. Sein Lebenswerk besteht nicht in territorialer Expansion oder militärischer Glorie, sondern in der Sicherung des Familienbesitzes unter veränderten politischen Vorzeichen und der Begründung der drei Hauptlinien seiner Nachkommen, die das Geschlecht derer von der Schulenburg bis in die Neuzeit hinein fortführten.
Quelle
- Paul-Werner von der Schulenburg; aus: Schulenburg'sche Ahnen im Spiegel ihrer Zeit
- Johann Friedrich Danneil: Das Geschlecht von der Schulenburg, Bd. 1–2, Salzwedel 1846–47 → Hauptquelle zu Biografie, Familienzugehörigkeit, politischem Wirken und genealogischer Einordnung.
- Ulrich von Richental: Chronik des Konstanzer Konzils (ca. 1420) → Darstellung der Belehnung Friedrichs VI. zum Kurfürsten von Brandenburg 1415.
- Ernst Friedländer: Friedrich VI. und die brandenburgische Politik, Berlin 1888 → Kontext zur Quitzow-Zeit, Fehden, Landfriedenspolitik.
- Gustav Albrecht: Die Quitzow-Zeit in der Altmark, in: ZPrG, Bd. 17 (1881) → Adelskonflikte, Klageschrift des Erzbischofs, Fehdetätigkeit von Fritz I.
- Fontane, Theodor: Wanderungen durch die Mark Brandenburg → Kulturgeschichtlicher Hintergrund zur märkischen Ritterschaft.